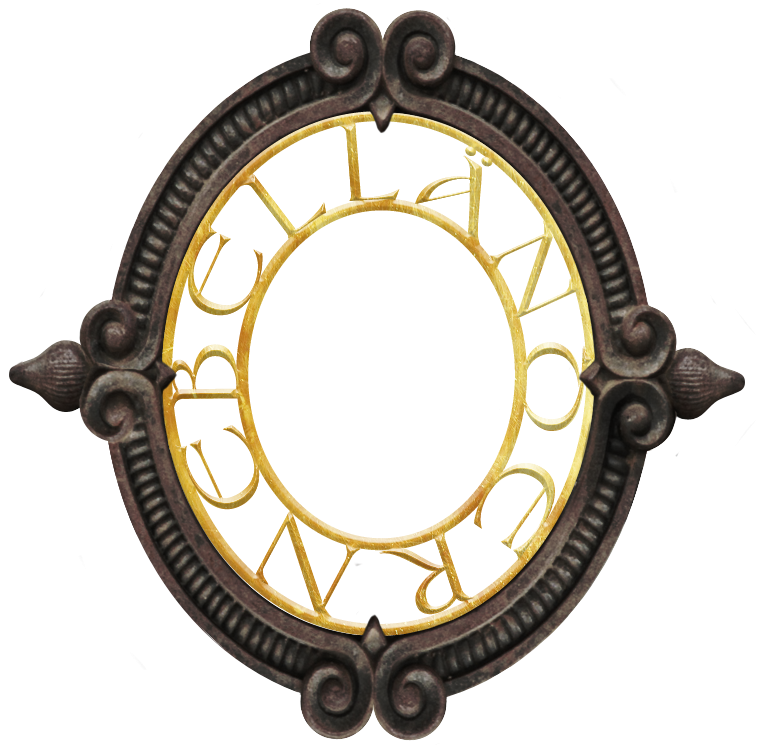aus "Der Widerstand formiert sich"
Prolog
Silufee steht am Ufer der Insel, die mitten im heiligen See Angleas liegt. Die Sonne taucht die Welt in ein schimmerndes, helles Rot und die lichten Wände des Glaspalastes scheinen im hellen Strahlen der Sonne zu erglühen. Nie gekannte Ruhe liegt über dem heiligen See. Doch Silufee zieht plötzlich den warmen Umhang fester um die Schultern, als ein Wind aufkommt, der schneidend über Anglea hinwegstreicht. Er bringt ein Flüstern und Wispern mit, das Silufees Ohren umspielt. Sie glaubt zuerst, nicht richtig zu hören, doch dann ist sie sich sicher. Es sind die Stimmen ihrer geliebten Toten, die sich zu einem warnenden Gemurmel vereinen. Die Sonne versinkt seufzend hinter dem Horizont und hinterlässt nur ein graues Geriesel und düstere Winde.
„Höre, Silufee“, erkennt die Königin der Brataner die Stimme ihres Mannes, der vor langer Zeit dahinschied. „Wind kommt auf. Er sät einen gefährlichen Sturm, der dein Leben gefährdet. Unsere Töchter sind in Gefahr und die Freiheit der friedlichen Insel. Die gerechte Fürstin wird erwachen. Der Glaspalast wird wanken, gar zerbersten. Sie ist die Einzige, die den Untergang verhindern kann. Meide deinen Palast! Sein Ende ist nahe“, hört sie die Stimme eindringlich warnen, ehe sie wie ein lichtes Sausen verstummt.
Silufee dreht sich entsetzt zum Glaspalast herum, der noch ehern hinter ihr steht, als sich unvermittelt der angedrohte Sturm erhebt. Sie läuft, wie ihr geraten wurde, vor dem Wind davon und wird von peitschenden Böen erfasst und an den Stamm einer Buche gedrückt. Er hält sie sicher und verhindert, dass sie in die Fluten des aufgepeitschten Sees versinkt. Da sieht sie Kalia erwachen. Sie entsteigt hastig dem tosenden See und fährt geradewegs in die rasenden Wolken. Einer befindet sich dort, den Kalia kennt und fürchtet. Es ist Fürst Berrex, der gebannte Silv, der nicht hier sein sollte. Berrex hat sich befreit und bedroht ihren Glaspalast. Blanke Gier führt ihn hierher. Die Gier nach Macht und Wissen, das ihm die Fürsten des Nebels stets verweigerten. Niemals sollte das alte Wissen in die Hände der abtrünnigen Silven gelangen. Denn dann würde das Reich der Nebelfürsten wanken. Berrex würde sie damit vernichten und die alleinige Herrschaft über die Welt der Nebelfürsten erlangen. Menschen und Silven wären gefährdet. Doch es ist kaum noch zu verhindern. Kalia steht ihm alleine gegenüber. Wie sehr ersehnt sie die Hilfe der befreundeten Fürsten.
Silufee kennt die Mächte, die in den Wolken aufeinanderstoßen, und sie bangt vor dem Sieg der Finsternis. Die unheilvolle Macht des Fürsten Berrex tobt in dunklen Feuern, die auf die lichten Schwerthiebe der Fürstin treffen. Tapfer schlägt sie in die düstere Gefahr, doch keiner ihrer Hiebe erreicht Berrex in seiner Macht. Er beginnt zu lachen über die kindlichen Bemühungen der gerechten Fürstin, kennt er doch ihren friedfertigen Sinn.
„Versuche es nicht länger, Freundin“, bittet er sie herablassend und fügt ihr einen Hieb zu, der sie fast vernichtet. Kalia wankt und strauchelt. Das wenige Licht, das sie verbreitet, vergeht fast in der Dunkelheit, die Berrex aufbietet. Da wendet sich der übermächtige Fürst gestärkt mit der Kraft der heiligen Buche dem Glaspalast zu. Unter dem Palast liegen die Rollen des Wissens. Die Allmacht der Welt ist dort beschrieben. Wer die Schriftrollen besitzt, ist der Herrscher der Welt. Berrex tritt an den Palast heran, befühlt die glatten, seidigen Mauern und ist fasziniert. Hier hat Kalia ein Meisterwerk vollbracht. Er bewundert es und bedauert seinen Fall. Doch noch ehe das ehrenhafte Gefühl vergangen ist, erzittern schon die durchscheinenden Mauern und Verfall kriecht durch die Wände. Die Decken ächzen und der Palast wankt. Er zerbirst unter den Händen des abtrünnigen Fürsten und sinkt in einem letzten Krachen zerstört auf die Erde. Er ist vernichtet und Berrex lächelt. Es war einfach gewesen. Er tritt mit sicherem Schritt über die Scherben der Glaswände hinweg direkt auf die freigelegte Treppe zu, die in die Tiefen Hastenis führt, der Unterwelt, die die Schriftrollen der Macht verbirgt. Er steht auf der ersten Stufe und ist sicher, in den nächsten Minuten das Erbe des Königs der Nebelfürsten anzutreten, als eine eisige Kälte seine Bewegungen verhindert. Diese Kälte erfasst alle seine Gliedmaßen gleichermaßen und Berrex kann sich nicht mehr rühren. Da hört er ein Schreien und Toben und sieht die helle Macht der Fürstin Kalia auf sich einwirken.
„Du hast den Glaspalast zerstört. Meinen Palast. Dir droht der Tod. Bereite dich vor auf das Nichts“, peitscht die eisige Stimme der Fürstin auf ihn ein. Sie ist rasend vor Wut. Sie hatte einst geschworen, denjenigen zu töten, der ihren Palast zerstörte. Sie bedient sich der kalten Macht, die sich in den aufgeschäumten Wellen ihres Sees entlädt. Kalia wächst übermächtig und steht Berrex gegenüber, der, in Kälte gefroren, nur zusehen kann, was nun geschieht. Er fühlt ihr lichtes Schwert seinen Hals berühren und wie in einem klirrenden Inferno zerbricht der gefrorene Fürst in abertausende Teile. Als sein Dasein verschwunden ist, kehrt die Kraft der Sonne wieder, erwärmt die Erde und verbrennt Berrex mit wütendem Zischen aus dieser Welt.
Erleichtert seufzte Silufee im Schlaf.
Die Priester des Nebels in Falkenweld
Der Sommer verabschiedete sich und eines Morgens, Ende Oktober 214, als Ilari in Falkenweld an die Brüstung der Burg trat, sah er einen schlanken, dunklen Mann durch das Tor reiten. Die Wachen folgten ihm und versuchten ihn aufzuhalten, aber er ritt unbeirrt weiter und hielt erst vor dem Eingang zum Haupthaus. Er hatte Ilari nicht gesehen, aber dieser hatte den Besucher erkannt. Ilari stürzte freudig erregt die Treppe hinunter.
„Theodric, du bist endlich da! Wir haben deine Ankunft schon sehnlichst erwartet. Wurdest du aufgehalten?“, rief Ilari glücklich. Aber eigentlich war es Ilari egal, er brauchte keine Antwort. Er war nur froh, den Freund wieder in seiner Nähe zu wissen. „Ich bin hocherfreut, dich zu sehen. Komm weiter mit mir in die warmen Hallen.“ Ilari hatte den Treppenabsatz erreicht und nahm den Freund ganz selbstverständlich in die Arme.
„Sag mir, was dich zu uns nach Falkenweld führt. Die Elstern können es nicht sein. Die hat schon ein anderer Bote gebracht und wir hatten bisher keine Verwendung für sie. Sie werden wohl in unserer Obhut dick und fett werden“, sagte Ilari glücklich und führte Theodric durch die große Halle in den Speisesaal, in dem an der einen Ecke der langen Tafel schon zum Frühstück gedeckt war. Dorthin setzten sie sich.
„Es gibt wieder einmal eine neue Herausforderung“, sagte Theodric nüchtern. „Ich habe viel Zeit mit meiner Mutter zugebracht, um die alten Schriften zu verstehen, die in Konbrogi in den Priestergebäuden liegen. Zu viel Zeit befürchte ich schon fast. Doch jetzt sind wir uns sicher, dass Falkenweld der Schlüssel zur Öffnung aller Übergangsorte ist.“ Theodric hielt einen Moment inne. „Außerdem lastet auf Falkenweld ein dunkles Geheimnis. Eines, das uns gefährlich werden kann.“
Ilari runzelte zuerst die Stirn, weil er ahnte, dass es sich um bedeutende Schwierigkeiten handeln musste, wenn Theodric selbst hier erschien. Aber Ilari wusste, Theodric würde sie lösen, da er ein großes Geschick dafür hatte, alle Dinge wieder ins Lot zu bringen.
„Beruhige dich, mein Freund. Ausweglose Lebenslagen sind doch nichts Neues. Wir müssen die Hindernisse eben aus dem Weg räumen. Damit können wir gleich nach dem Frühstück anfangen. Jetzt musst du dich erst einmal erholen, denn du siehst aus, als wärst du die Nächte hindurchgeritten“, bemerkte Ilari, der die tiefen Ringe unter Theodrics Augen gesehen hatte. Sie hatten beide nicht wahrgenommen, dass Morwenna plötzlich an ihrer Seite stand und ihnen zulächelte. Theodric sah Morwenna zuerst neugierig und danach überrascht an. Dann lächelte er zurück.
„Wann wird das Kind zur Welt kommen, das du erwartest, Morwenna?“, fragte er und Morwennas Wangen röteten sich. Ilari sah verwundert auf seine Frau. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass ihm heute jemand mitteilen würde, er würde bald Vater werden. Während sich Morwenna sammelte, fing Ilari an, Gefallen daran zu finden, bald Kinderfüße im Haus zu hören. Er sah Morwenna verliebt an und hätte sie fast auf seinen Schoß gezogen, doch sie waren nicht alleine. Gerade brachten einige Dienerinnen neuen Wein und Brot in den Saal. Deshalb schwiegen die drei und warteten ab.
„Im Mai wird das Kind kommen, sagt die Hebamme, und ich wollte es dir schon gestern berichten, Ilari, aber du hattest keine Zeit. Ich weiß es seit längerem, aber ich wollte mit der Mitteilung abwarten, bis keine Gefahr mehr droht, das Kind vorzeitig zu verlieren. Diese Gefahr ist nun gebannt und wir können in aller Ruhe unser erstes Kindes erwarten“, sagte Morwenna und lächelte ein neues Lächeln, das mehr nach innen gerichtet war. Ilari sah es und war glücklich, weil er bemerkte, wie sehr sie sich auf ihr Kind freute. Nach einer kurzen Pause schob die Herzogin ihre Schwangerschaft zur Seite und begann Theodric auszufragen. Seine Antworten erwiderte sie mit einer gerunzelten Stirn.
„Ich muss die alten Schriftrollen und Bücher auf Falkenweld einsehen, die die Priester des heiligen Hains hier hinterlassen haben. In den nächsten Tagen werden einige Priester aus Wallis hier eintreffen, die mich unterstützen werden. Es sind gelehrte Frauen und Männer, die hier in Falkenweld den Priesterorden wieder ins Leben rufen möchten, wenn ihr beide nichts dagegen habt. Es ist euer Land und wir haben kein Recht darauf, die alten Landstriche für den Orden von euch zu fordern“, sagte Theodric in seiner leisen und nüchternen Art. Er sah auf Morwenna und überlegte, ob sie zu den Frauen gehörte, die in einer Schwangerschaft unvernünftig handelten. Er fragte sich, wie sie in ihrem Zustand mit den Problemen Ambers umgehen würde. Aber noch ehe er diesen Gedanken zu Ende gebracht hatte, sah er in Morwennas Augen etwas aufblitzen. Sie schien über einiges angestrengt nachzudenken.
„Wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben hier früher die Priester des Nebels gelebt. Ein Orden, der aus Männern und Frauen bestand, die friedlich miteinander in den Priestergebäuden außerhalb Falkenwelds lebten und hie und da auch einige Kinder in die Welt setzten. Ich weiß von zwei Dienerinnen, die die Abkömmlinge dieser Priestergemeinschaft des Nebels sind. Sadie Danvers und Hilda Rapp sind lebenskluge und vorausschauende Frauen, die selbst schon Kinder haben, die aber noch von ihren Eltern in der Tradition der Priesterschaft erzogen wurden. Man behauptet, sie kennen die heiligen Orte und die Wege dorthin und wissen einiges andere mehr, das dir hilfreich sein kann. Außerdem behaupten sie, dass auf Falkenweld einer der Schlüsselorte der Nebelländer auf Amber liegt. Sie betonen auch, dass in alter Zeit der hiesige Nebelorden einer der wichtigsten für die Nebelfürsten auf Amber war. Der Weg dorthin ist verwirrend und einfache Menschen finden ihn nicht. Das wurde in alten Zeiten von den Fürsten der Nebelländer so festgelegt. Nicht jeder sollte die alten Weihestätten, die sie selbst als Tor nach Amber in Anspruch nahmen, betreten können. Weil ich ihnen glaube, möchte ich das alte Ordensgelände, dessen Gebäude zum Teil verfallen sind, wie mir die Frauen berichteten, wiederaufleben lassen. Es sollen neue Unterkünfte für die Männer und Frauen entstehen und die Umgebung darum herum soll wieder ihrer alten Verwendung übergeben werden. Es sind ausgedehnte Landschaften, die einstmals zum Orden gehörten. Sie wurden als Äcker und Weiden für ihr Vieh genutzt, weil die Priester sehr abgeschieden lebten. Doch all das wird sich mit den alten Schriften feststellen lassen. Geh also zu den beiden Frauen, Theodric, und mache dich kundig über die Dinge, die sich einstmals hier befunden haben. Im Keller der Burg Falkenweld gibt es Räume, die die Schriften beherbergen. Dorthin wirst du dich des Tages mit einer Kerze zurückziehen müssen. Aber wenn du des Abends wieder hervorkommst, dann, hoffe ich, verbringst du deine Zeit mit uns, die dich schon so schmerzlich vermisst haben.“ Morwenna sagte nun nichts mehr. Es waren viele Gedanken, die sie offensichtlich schon seit längerem mit sich herumtrug und die sie endlich in Theodrics Beisein aussprach. Sie hatten wie eine Last auf ihr gelegen, weil es Dinge waren, die eilig erledigt werden mussten, zu denen sie sich selbst aber nicht in der Lage fühlte. Daher sah sie mit Freude, mit welcher Begeisterung Theodric diese Last auf seine Schultern nahm. Dabei war sie glücklich, ihn tatkräftig unterstützen zu können.
„Ich höre erfreut, dass ich die Unterstützung der beiden schriftkundigen Frauen erhalten kann. Doch denke ich, sie sind einfach in ihrer Denkweise und keine geschulten Gelehrten. Deshalb werde ich erst alleine versuchen, die Schriftrollen, die auf Falkenweld aufbewahrt werden, zu prüfen. Wenn mich mein Gefühl nicht trügt, werde ich alleine zu der richtigen Erkenntnis gelangen“, sagte Theodric und ließ keinen Zweifel daran zu, dass er sich befähigter fühlte als die beiden einfachen Frauen, das Rätsel Falkenwelds zu lösen.
„Mach es, wie du denkst, mein Freund. Ich bin mit diesen Dingen hinlänglich überfordert“, sagte Ilari versöhnlich, der sich zwar wunderte, warum Theodric es sich antun wollte, tagelang in den verstaubten Kellern herumzukriechen, wenn er die Antwort auf alle Fragen auch einfacher haben konnte. Aber da er kein Gelehrter war und Theodrics herablassende Art kannte, wenn es sich um seine Gelehrsamkeit drehte, beschloss er, sich nicht einzumischen. „Wenn du auf Schwierigkeiten stößt, dann zögere nicht, uns einfache Menschen um Hilfe zu bitten.“ Er sah Theodric noch einmal genauer in die Augen und beließ es dabei.
„Doch jetzt verrate uns, was dich so sehr zu dieser Arbeit drängt“, wollte Ilari noch wissen. Theodric sah zuerst zu Boden und wollte nichts darüber sagen, aber Morwennas ernster Blick forderte ihn auf zu sprechen.
„Ich möchte euch nicht beunruhigen, aber wir haben einige Neuigkeiten über Fürst Berrex erhalten, den dunklen Fürsten der Nebel, die uns Sorge bereiten“, begann Theodric vorsichtig. „Fürst Ewen hat herausgefunden, dass es möglicherweise für Berrex eine Möglichkeit gibt, sich seiner Fesseln zu entledigen, wenn er eines bestimmten Kleinodes habhaft wird, das sich auf Falkenweld befindet. Ich vermute wohl zurecht, dass es auf dem alten Priestergelände versteckt worden ist. Dort muss es etwas geben, das Fürst Berrex dringend begehrt. Deshalb bin ich gleich darauf wie der Wind nach Falkenweld geeilt. Hier, denke ich, wird sich für uns und für die Fürsten der Nebelländer das Schicksal erfüllen.“ Das klang äußerst bedenklich und Morwenna, die seit ihrer Schwangerschaft gefühlvoller war als Ilari, erschrak zurecht. Aber Ilari, der immer ein wenig kühner mit allem umging, was andere Menschen beunruhigte, sah es gelassener.
„Dann mach dich daran, Theodric, finde es heraus und hole dir Hilfe von wem auch immer. Die Elstern sind bereit, um Nachrichten zu entsenden. Und die Dienerinnen des Nebelordens und die vergessenen Schriften stehen dir zur Verfügung. Es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht in absehbarer Zeit einiges über die Dinge wüssten, die Berrex, das dunkle Ungeheuer, gegen uns verwenden will“, sagte Ilari zuversichtlich. Er war und blieb ein Nordmann, der immer lieber an seine Möglichkeiten dachte, als sich von etwaigen Unwägbarkeiten ins Bockshorn jagen zu lassen.
Theodric machte sich sofort nach dem Frühstück daran, die alten Schriften zu sortieren und zu prüfen. Er war von da an in den muffigen Gemäuern des Kellers verschwunden. Man bekam ihn kaum noch zu Gesicht und selbst bei den Mahlzeiten wurde er immer unzugänglicher und verschlossener. Doch schon nach einigen Tagen kannte er alle wichtigen Schriften, die den Nebelorden betrafen. Es schien Ilari, als ob er die Hilfe der schriftkundigen Frauen Falkenwelds nicht benötigte. Aber da irrte sich Ilari. Theodric verbiss sich in die Heiligen Schriften und konnte doch darin nicht die fehlenden Hinweise auf den Weg zum heiligen Hain auf Falkenweld finden. Genau darüber gab es kein Wissen, das ansonsten recht umfassend war. Es machte ihn zuerst stutzig und dann wütend, weil er befürchtete, dass er nirgends Aufzeichnungen darüber finden sollte. Die unschätzbar wichtigen Seiten schienen für ihn verloren zu sein. Ganze Seiten mussten aus den Büchern herausgerissen worden sein. Oder, was Theodric viel eher vermutete, es fehlten ganze Bände mit dem gesammelten Wissen der Priestergemeinschaft. Er befürchtete, dass sie sich möglicherweise in den verfallenen Gebäuden und Kellern der Priester am heiligen Hain befanden. Doch da er nicht wusste, wie man dorthin gelangen konnte, geriet er in eine düstere Stimmung, die ihn für einige Zeit vergessen ließ, dass dieses Wissen von den beiden Frauen des Nebelordens bewahrt wurde. Morwenna beobachtete einige Tage lang die fragile Stimmungslage des Freundes und sorgte sich. Eines Abends erschien Theodric sehr übel gelaunt in der Halle und brachte keinen Appetit mit.
„Man muss sich die Sprüche ansehen, die im Buch der Lieder aufgeschrieben sind“, sagte er mit matter Stimme. „Sie weisen den Weg, steht in einer der Schriftrollen“, bemerkte er entmutigt. Als er so einige Zeit am Tisch zubrachte, schob er seinen gefüllten Teller missgelaunt von sich weg. Theodric hatte keinen Hunger und auch der teure Wein aus dem Süden besserte seine Laune nicht. Fast schien es allen, als hätte sich sogar das Wetter der unheilvollen Stimmung in der Burg angepasst. Draußen stürmte und tobte der Wind. Der Regen klatschte klagend gegen die Mauern und ließ die Fensterläden erzittern. Ilari war froh, nicht nach draußen gehen zu müssen. Sogar die Hunde ließ man bei diesem Wetter im Haus. Er saß neben Theodric und machte sich seine Gedanken zur ungewohnten Mutlosigkeit seines Freundes. So ein Verhalten war nicht alltäglich und er befürchtete, dass die Zukunft aller Menschen gefährdet wäre, fänden sie nicht in nächster Zeit den Weg zum heiligen Hain. So begann Ilari, trübsinnig in den Wein zu blicken, und nur Morwenna behielt ihre hoffnungsfrohe Stimmung. Sie lächelte immer noch und gab einem der Diener schließlich einen Wink. Als sie ein leises Klopfen an der Türe hörten, sah sich Theodric mürrisch danach um und erntete nur ein fragendes Gesicht, als er Ilari ansah. Doch Ilari winkte ab. Als jedoch Morwenna noch breiter lächelte und sich die Türe öffnete, durch die zwei junge Frauen hereintraten, fingen die beiden Männer an, einiges zu vermuten.
„Kommt an die Tafel, ihr beiden“, forderte Morwenna die Frauen auf und winkte ihnen zu, Platz zu nehmen. „Es gibt Speise und Trank, wenn ihr danach begehrt“, sagte sie aufmunternd zu den jungen Frauen. Diese nickten, legten ihre nassen Umhänge auf einem Stuhl vor dem Feuer ab und traten zu Morwenna, die sie zu kennen schienen. Dann grüßten beide die ernst gestimmten Männer und setzten sich schüchtern auf die Kante ihrer Stühle. Theodric hatte sofort begriffen, dass es sich um die kundigen Frauen handeln musste, von denen Morwenna gesprochen hatte. Dass sie so prompt erschienen, gerade als er sie am dringendsten brauchte, verstörte ihn zuerst, doch dann vermutete er, dass Morwenna die Frauen für heute Abend in die Burg gebeten hatte. Theodric musterte sie erwartungsvoll. Sie machten einen guten Eindruck auf ihn. Still, klug und zurückhaltend waren sie. Doch nicht unterwürfig, lediglich abwarteten saßen sie auf ihren Stühlen und nahmen ihn schließlich in Augenschein. Dann trieb die Unruhe Theodric an, sie auszufragen.
„Besitzt ihr überliefertes Wissen über die Priester des Nebelordens, wie mir die Herzogin berichtete?“, fragte er sie und klopfte dabei ein wenig ungeduldig mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte. „Ihr wüsstet auch den Weg zum heiligen Hain, behaupten einige.“, fügte er erwartungsvoll hinzu und nahm seinen Blick nicht mehr von ihnen. Er ließ seine Augen erwartungsvoll abwechselnd von einer Frau zur anderen wandern und ärgerte sich ein wenig über ihre vorsichtige Zurückhaltung. Es schien ihm, als wüssten sie tatsächlich über alles Bescheid und hielten ausgerechnet ihn für einen Scharlatan, der ihnen ihr sorgsam gehütetes Geheimnis zum Eigennutz entlocken wollte. Fast riss ihm der Geduldsfaden, wie er so saß und dem ungeduldigen Heulen des Windes lauschte, der seine innere Unruhe nur verschlimmerte. Der Regen hatte unerwartet aufgehört und die Fensterläden schwiegen plötzlich stille, weil der Sturm zur Ruhe gekommen war. Eine der jungen Frauen brach endlich ihr Schweigen und antwortete ihm jetzt völlig unumwunden.
„Mein Herr“, sagte Sadie Danvers leise, „wir wissen vieles über den Orden, was nicht in den Büchern steht. Einige der Bücher, die ihr so leidenschaftlich sucht, werden schon seit Menschengedenken vermisst, aber deshalb ist das Wissen daraus nicht verlorengegangen. Unsere Eltern haben uns Dinge gelehrt, die wir anfangs nicht verstanden und auch jetzt noch nicht verstehen. Aber sie versprachen uns immer, es würde einstmals einer kommen, der alle Geheimnisse lüften würde. Den Weg zum verlassenen Orden und dem heiligen Hain kennen wir sehr gut. Wir sind ihn schon unzählige Male gegangen. Der Hain ist unser zweites Zuhause, doch teilen wir unser Wissen gewöhnlich nicht mit jedem. Nur die Menschen, die wie wir erwählt wurden, kennen den Weg zum Opferplatz der Fürsten der Nebelländer. Dort bringen wir ihnen wie in grauen Vorzeiten unsere Opfer dar. Wir haben niemals damit aufgehört, seit sich der letzte Fürst in den Über¬gang zurückzog, als das Tor zu den Welten der Nebel unwiderruflich verschlossen wurde. Wir versprachen diesem Fürsten damals, auf ihn zu warten, und hielten seitdem das Erbe der Fürsten hoch, wenn auch nur in der Stille des Ordens, weil die einfachen Menschen nicht verstanden hätten, was wir tun. Aber uns haben die Fürsten seit ewigen Zeiten nicht mehr geantwortet. Deshalb glauben wir, dass der Ort verschlossen ist, wohl seit der Zeit des Ersten Krieges. Und niemand konnte ihn bisher wieder öffnen, obwohl wir es regelmäßig versuchten“, sagte sie mit ihrer ruhigen, dunklen Stimme. Und eine tiefe Bestürzung über etwas Unheilvolles überzog ihre Miene und sie begann zu schweigen.
„Der heilige Ort bleibt verschlossen, bis uns ein großes Unheil bedroht, mein Herr“, fuhr Hilda Rapp stattdessen fort. „Es heißt, erst dann werden wir ihn mit dem Gelehrten, der in Falkenweld erscheinen wird, wieder öffnen können. Die Verheißung besagt, dass das dunkle Schicksal eines Fürsten mit Falkenweld und seinem Priesterorden verbunden ist. Wir wissen es schon lange. Doch seitdem ihr Falkenweld betreten habt, glauben wir, dass die Verheißung der Ahnen in unserer Zeit in Erfüllung geht“, berichtete die helle Stimme Hildas, die schmal wie ein Tuch war, aber so zäh wie eine alte Eiche im Wind wirkte. „Bist du der, den wir schon lange erwarten?“, fragte sie Theodric. „Es soll jemand sein, der aus den dunklen Wäldern kommt, um mit uns das letzte Geheimnis zu lüften, das den dunklen Fürsten betrifft.“ Es war weniger eine Frage als eine Feststellung. Alles, was hier und heute geschah, schien sich in die Verheißung ihrer Vorfahren zu fügen und es schreckte Hilda ein wenig, dass es zu ihren Lebzeiten geschehen sollte. Theodric erschauderte ebenso, weil er erkannte, wie schicksalhaft seine Aufgabe war. Und wie sehr die Rettung seiner Welt von ihm abhing. Die Last dieser Bürde senkte sich auf seine Schultern und für einige schwere Augenblicke schien er unter dieser Belastung zusammenzubrechen. Dann straffte er sich und nahm sein Schicksal demütig an. Es lohnte sich nicht, sich der Bestimmung zu verweigern. Theodric verdrängte die Eiseskälte und die zermürbende Angst, die sein Herz umfing. Er wusste nun, dass die vagen Vermutungen, die er und seine Mutter mit Berrex in Zusammenhang gebracht hatten, richtig waren und dass sie einige Zeit benötigten würden, um alle Gefahren zu abzuwehren, die auf sie zurollten. Sie befanden sich ganz am Anfang ihrer Aufgabe, aber es war noch nicht alles verloren. Noch war Zeit. Sie mussten neben allem anderen schnellstens in Erfahrung bringen, um welches Kleinod es sich handelte, mit dem Berrex und sein gefährliches Volk wieder ihre ursprüngliche Macht zurückerhalten wollten. Doch statt entmutigt zu sein, wurde Theodric geradezu euphorisch und wollte sich sofort ans Werk machen. Er befürchtete, schon im nächsten Augenblick in eine Falle des dunklen Fürsten zu tappen. Er war von dem Wissen der beiden Frauen abhängig. Er beruhigte sich wieder und beschloss, den Frauen auf den Zahn zu fühlen. Er musste sicher sein, dass sie in die Geheimnisse des Nebelordens eingeweiht waren.
„Teilt euer Wissen mit uns“, verlangte er fast schon herrisch von ihnen. „Es soll eine Wegbeschreibung zum heiligen Hain geben, habe ich in den Schriften tief im Keller der Burg gelesen. Sie erklärt ausführlich, wie man vom Hof der Burg Falkenweld über die Lande gehen muss. Kennt ihr solch eine Wegbeschreibung?“, fragte er sie. Seine Worte klangen wie ein ungeduldiger Befehl, denn Theodric hatte seine Geduld schon vor Tagen in den Kellergemäuern Falkenwelds verloren. Sadie antwortete ihm wieder zuerst.
„Natürlich kennen wir den Spruch der Fürsten, der zum heiligen Hain führt. Ihr könnt ihn entweder heute schon von uns hören oder gleich morgen mit uns reiten, wenn wir den Weg für euch beschreiten, falls ihr es von uns verlangt“, sagte sie einfach und erkannte damit Theodric als den erwarteten Gelehrten aus Konbrogi an. Doch Theodric schüttelte den Kopf.
„Ich mag nicht bis zum Morgengrauen warten, um zu wissen, ob ihr recht habt. Ich bin es leid, etwas zu vermuten, ich will es jetzt wissen. Sonst verliere ich den Verstand. Es hängt zu viel von euch beiden ab. Das wisst ihr hoffentlich“, sagte er und sah sie weiterhin durchdringend an. Beide lächelten und dann sprach Hilda wie auf ein unsichtbares Zeichen hin.
„Reite hinter die Burg den Falk entlang.
Lass dich nicht schrecken vom Feld der Gräber.
Es liegt im Nebel seit Beginn aller Tage. Reite den Falk entlang.
Gelange wie er durch die Schlucht der fallenden Steine, den Kopf stets geneigt.
Das Wasser fällt von oben durch Kalias Auge.
Benutze die Brücke, die über das Auge flieht.
Trenne dich vom Falk, er zieht friedlich weiter als trudelndes Wasser.
Erkenne Cialaes Gesicht, es mustert feindlich den Fremden.
Erklimme ihre Stirn, von dort siehst du das Tor.
Das Tor der Könige führt hinunter zur heiligen Höhle.
Durch sie hindurch, dem Licht entgegen, hinaus in den irrenden Wald.
Dort führt dich der samtige Pfad zum Baum der Geschichte, er flüstert. Farnüberwucherter Boden, schlanke Buchen. Sie führen zum heiligen Hain.
Acht Eichen und Buchen, Jahrhunderte alt.
Sie stehen im Wechsel, kreisrund wie die Sonne.
Inmitten der Platz für die Opfer an die Fürsten.“
Sie schwieg schließlich und alle Anwesenden hielten den Atem an. Nur das toben des Windes, der wieder zornig begonnen hatte, an den Türen und Hölzern der Burg zu rütteln, war zu hören. Der Regen hatte aufgehört zu prasseln. Alle wussten, dass es der richtige Spruch war, und Theodric atmete leise auf. Er traute es sich nun zu, den Weg alleine zu finden. Doch wollte er einem unerwarteten Scheitern vorbeugen und war ergeben genug, die Führung dorthin den beiden kundigen Frauen zu überlassen.
„Wir treffen uns bei Sonnenaufgang im Burghof“, sagte er den Frauen und bedankte sich bei ihnen. Sie nickten, standen auf und warfen sich die Umhänge über. Endlich kam etwas in die Gänge, auf das sie schon ihr ganzes Leben vorbereitet worden waren. So wie ihre Eltern zuvor und alle andern, die lange vor ihnen den Weg der Priester des Nebels gegangen waren.
Die sieben Gefahren
Als sich die Sonne gerade am Horizont gezeigt hatte, ritten sie los. Auch Oliver Hurst kam mit. Er war derzeit der Verwalter des Gutes und musste über diese Dinge Bescheid wissen. Theodric ließ ihn bei seinem Leben schwören, über alles, was sich an diesem Tag ereignete, auf ewig zu schweigen. Sie ritten hinter der Burg los und den launischen Fluss Falk entlang. Es war ein wunderbar warmer und sonniger Morgen. Sie waren guten Mutes und gelassen und sie freuten sich darauf, den heiligen Hain endlich zu sehen. Der Falk führte viel Wasser nach dem heftigen Regen der letzten Tage und sprang munter neben ihnen her. Sie ritten stets nach Norden und nach kurzer Zeit verschlechterte sich das Wetter ohne ersichtlichen Grund. Die Sonne war nach einigen Augenblicken verschwunden, fast so, als hätten sich Wolken vor sie geschoben, Wolken, die es aber am Himmel gar nicht gab. Aus den Feldern neben ihnen stiegen unerwartet dichte Nebelschwaden auf und schon bald konnten ihre Augen nicht mehr eindeutig erkennen, was unmittelbar vor ihnen lag. Ilari runzelte die Stirn. Ihm gefiel es hier nicht. Er ahnte, dass etwas Unheimliches vor sich ging und wäre gerne wieder umgekehrt. Aber als er auf Sadie blickte, die weiterhin ruhig und unbeirrt in den abweisenden, feuchten Dunst hineinritt, beruhigte er sich ein wenig. Sadie Danvers schien alles, was hier vor sich ging, zu kennen. Die Geräusche der Umgebung, die zahlreich an ihre Ohren drangen, wirkten unvermittelt gedämpfter als vorher und alle zogen es vor zu schweigen. Nach einer langen und unangenehmen halben Stunde sahen sie ein hügeliges Feld vor sich liegen, das ihnen wie ein verlassener Friedhof erschien. Es erstreckte sich, wenn sie es richtig einschätzten, unendlich weit vor ihnen in die Ferne. Das magere Gras war mit feinem Raureif überzogen, wie es nur im Winter vorkam. Die Halme wuchsen nicht sehr hoch zwischen den teilweise schon umgefallenen Grabsteinen. Die ungleichen, grob behauenen Steine standen schief und geduckt im kalten, grauen Nebel, der die Finger der Menschen klamm werden ließ, weil sie die Zügel ihrer Pferde vor Sorge fester umklammerten. Die Frauen zogen sich ihre Umhänge dichter um die Schultern und Morwenna begann zu frieren. Ilari wurde ungeduldig.
„Wie kann es bloß plötzlich so kalt und düster sein?“, fragte Ilari Theodric, der dicht neben ihm ritt. „Die Sonne stand gerade noch warm und einladend am Himmel und scheint sich jetzt furchtsam vor diesem unwirtlichen Feld wegzuducken“, murrte er weiter und musste sich konzentrieren. Er ließ sein Pferd die schief stehenden, halb umgefallenen Steine vorsichtig umgehen. Er wollte verhindern, dass es fehltrat, sich verletzte und sie gezwungen wären, hier länger zu bleiben als notwendig. Sie ritten von Sadie geführt ohne einen Pfad mitten durch die Gräber hindurch und sahen, als sie eine flache Anhöhe erreicht hatten, am anderen Ende doch nur wieder den dichten Nebel, der undeutlich in den diesigen Horizont überging. Reif lag auf den rauen Steinen und nur das monotone Krächzen einzelner Raben, die sich in ihrer Nähe aufhielten, war zu hören.
Morwenna, die hinter Ilari ritt, spürte den Hauch des Todes und erschrak. Sie sah entsetzt, wie Ilari vor ihren Augen jählings im Nebel verschwand. Sie sah sich besorgt nach den anderen um, doch sie waren ebenso verschwunden wie Ilari. Da begriff Morwenna entsetzt, dass sie hier im Nebel alleine geblieben war. Ihre Kehle zog sich zusammen und verschloss das Grauen in ihrer Seele. So sehr sie es auch Mal um Mal versuchte, kein Laut entfuhr ihrer Kehle, kein Ton entwich ihren Lippen. Grauenvolles Schweigen und erbärmliche Kälte machten sich um sie breit. Sie versuchte, nach Hilfe zu rufen, doch sie gab es auf. Enttäuscht schloss sie die Lippen. Da erahnte sie den Tod, der ihr greifbar nahe war. Jetzt wäre sie endlich fähig, sich bemerkbar zu machen. Doch nun presste sie mit aller Kraft die Lippen zusammen, um nicht zu schreien, weil es ihr in dieser Lage ratsam erschien zu schweigen. Es war ihr, als müsste sie dem unaufhörlichen Drängen des Todes widerstehen, der begehrlich nach ihr verlangte, seit sie das Gräberfeld betreten hatte. Als sie versehentlich über ein Grab ritt, das von schief stehenden Steinen umrundet war, drohte sie, die Nerven völlig zu verlieren. Sie wusste, sie war nun unweigerlich gefangen in der Welt des Todes. Morwenna ließ die Zügel abrupt los und wollte sich dem Drängen und Werben des Jenseits hingeben, als Hilda überraschend an ihrer Seite war und sie zu beruhigen versuchte.
„Herrin, hört mich an! Ihr müsst mit mir schnell zu den anderen aufschließen. Sie sind schon ein wenig im Nebel verschwunden. Wenn wir nicht sofort den düsteren Nebel verlassen, werden wir hier unser Verderben finden“, sagte sie aufgeregt und sah Morwenna dabei in die Augen, die ihr jedoch nur mit einem trüben Blick antworteten. Sie kann mich nicht hören, dachte Hilda und erkannte, dass sich Morwenna schon tiefer im Reich des Todes befand, als sie angenommen hatte. Hier drängt die Zeit, ermahnte sich Hilda, und weil Morwenna sie nicht hörte, griff sie ihr entschlossen in die fallengelassenen Zügel und führte das Pferd bedächtig weiter über andere Gräber, die tief eingesunken vor ihr auftauchten. Hilda war wütend, weil sie wusste, dass eine schwangere Frau eigentlich nicht hierherkommen sollte.
„Es dauert nicht mehr lange, Herrin, und wir haben die Gräberfelder hinter uns gelassen“, versprach sie Morwenna, weil sie hoffte, dass ihre Worte bald wieder gehört würden. Hilda nahm die Zügel des Pferdes ihrer Herrin fester in ihre Hände, um sie sicher hinter sich zu führen, weil sogar sie spürte, wie sich die düstere Stimmung Morwennas langsam auf die Pferde übertrug. Sie wurden widerspenstiger und versuchten auszuscheren. Und Morwenna ergab sich einfach ihrem Schicksal. Sie starrte wie gebannt nach rechts und nach links auf die Gräber, die sie kalt gähnend lockten. Morwenna fragte sich, wie alt die Gräber waren, ahnte jedoch, dass sie seit dem Anbeginn der Zeit dort verlassen und vergessen lagen. Sie erblickte plötzlich Hilda und erkannte, wie diese sich bemühte, sie weiterzuführen. Morwenna wunderte sich darüber, weil es doch so viel einfacher wäre, sich seinem Schicksal zu ergeben. Die Toten würden sie beide mit Freuden zu sich nehmen. Sollte Hilda sich bemühen, am Ende würden die Toten bekommen, was sie sich ersehnten. Aber weil Morwenna Hilda mochte, verweigerte sie sich ihr nicht länger und ließ sich schließlich von ihr ruhig wegführen. Auch Ilari und Theodric, die neben Sadie und Oliver herritten, fühlten sich plötzlich unwohl. Ilari, der an seine Frau dachte, die er schon länger nicht mehr gesehen hatte, drehte sich nach ihr um und konnte sie nirgends entdecken.
„Wo ist Morwenna?“, fragte er aufgeregt. Theodric, der noch nicht einmal bemerkt hatte, dass sie nicht mehr hinter ihnen ritt, fuhr der Schreck in die Glieder. „Hilda ist ebenso verschwunden“, setzte Ilari noch nervöser hinzu. Theodric wunderte sich einen Augenblick lang, dann dachte er nach. Er hatte von diesem Gräberfeld gelesen und begriff, dass feinfühlige Menschen hier fehlgehen konnten. Morwenna war schwanger und war damit diejenige, die für die Toten, die das Gräberfeld bewohnten, am begehrenswertesten war.
„Sie dürfen nicht zurückbleiben“, rief Theodric Ilari kurz angebunden zu und wendetet ohne ein weiteres Wort sein Pferd. Ilari kannte Theodric und begriff auf der Stelle, dass sich Morwenna und Hilda in ernster Gefahr befanden. Er schloss zu Theodric auf und zusammen ritten sie ein Stück zurück bis zu der Stelle, an der Theodric Hilda zuletzt gesehen hatte. Doch als sie sich in diesem trüben Licht umsahen, blieben Morwenna und Hilda trotzdem verschwunden. Theodric wurde nachdenklich und beruhigte Ilari, der nun sehr aufgebracht schien. Er ahnte wie Theodric, dass hier unheimliche Dinge vor sich gingen. Ilari wollte nach Morwenna rufen, als er ein leises Gemurmel hörte. Es kam nicht von Oliver und Sadie, die zu ihnen aufgeschlossen hatten, sondern drang wie aus weiter Ferne zu ihnen herüber. Als das Murmeln deutlicher wurde, sahen sie zuerst zwei verschwommene Schatten und dann deutlicher zwei Pferde mit Reitern darauf, die wie aus einer dichten, undurchdringlichen Nebelschwade entstiegen waren und geradewegs auf sie zugeritten kamen. Ganz langsam und vorsichtig ritten sie, so als suchten sie angestrengt ihren Weg. Da sah Ilari zuerst Hilda und wollte schon freudig auf sie zustürzen, als Theodric ihm in den Arm griff und ihn davon abhielt. Als Ilari nicht abwarten wollte, griff Theodric ihm entschieden in die Zügel.
„Bleib ruhig, Ilari“, flüsterte er. „Sie suchen noch nach dem Weg und können mit jedem Schritt fehlgehen. Sie sind auf der richtigen Fährte, doch sie dürfen nicht abgelenkt werden“. Ilari stutzte, hielt sein Pferd an und wartete ab, obwohl es ihm schwerfiel, denn er erblickte nun auch Morwenna, die hinter Hilda herritt. Sie schien nicht mehr in ihrer Welt zu sein und Ilari sah finster vor sich hin. Dann plötzlich hörte er ein freudiges Aufatmen. Es kam von Sadie, die angespannt schweigend neben ihnen stand. Sie verfolgte, welchen Weg Morwenna und Hilda nahmen, und sie wusste, dass sie gleich gerettet sein würden.
„Sie verlassen den Weg der Toten, Herr. Sie werden gleich wieder in der Welt der Lebenden sein. Die Übergänge hier sind fließend und eure Frau muss von den Toten gelockt worden sein. Wäre sie zu weit in die falsche Richtung gegangen, hätte sie niemand mehr retten können. Aber Hilda scheint ihr gefolgt zu sein und hat sie wieder zu uns geführt. Es ist ein schwerer Weg, den Hilda genommen hat, und hätte sie nicht ihre Ruhe bewahrt, sie wäre mit eurer Frau im Totenreich verschwunden“, sagte sie unaufgeregt. Ilari zuckte ein wenig zusammen, weil er begriff, in welcher Gefahr Morwenna geschwebt hatte.
„Müssen wir mit ähnlichen Gefahren rechnen, wenn wir weitergehen?“, fragte Oliver, der gerade glaubte, ein Gespenst aus den Gräbern aufsteigen zu sehen. „Ich sehe nämlich eine Gestalt, die aus dem Boden gewachsen scheint und nun auf uns zukommt. Aber das ist sicher eine Sinnestäuschung“, vermutete er und hoffte, dass es wirklich so wäre. Doch Theodric wusste es besser.
„Das ist es nicht, Oliver. Die Toten stehen auf, um Morwenna und Hilda davon abzuhalten, zu uns zu gelangen. Dabei sind wir nicht länger vor ihnen verborgen. Hilda wird wissen, was zu tun ist, aber ihr müsst ruhig bleiben, wenn die Toten um uns sind. Auch wenn ihr sie vertreiben wollt, bleibt trotzdem so gelassen, als wären sie nicht bei uns. Erst wenn wir uns gegen sie wehren und sie abweisen, können sie uns ergreifen und uns in ihre Gräber ziehen. Wir würden dort alle vergehen und wären vergessen, als wären wir nie dagewesen.“
„Irgendetwas hat sie zu früh geweckt. Ein fauler Zauber ist uns zuvorgekommen. Sie dürften eigentlich unsere Anwesenheit gar nicht wahrgenommen haben“, sagte Sadie nachdenklich. Und noch ehe sie ihre Worte beenden konnte, sahen sie weitere Gestalten aus dem Boden aufsteigen. Sie trugen weiße, durchscheinende Gewänder und hatten die bleichen Gesichter der Toten. Einige von ihnen lächelten und deuteten, wie zuvor auch bei Hilda und Morwenna, ihnen an, vom Pferd zu steigen. In der Gruppe schwiegen alle entsetzt und erstarrten auf ihren Pferden. Als sich Oliver schließlich zu sehr fürchtete, schloss er die Augen, um nicht verführt zu werden, nach ihnen zu greifen und sie zu berühren. Sie hörten ein aufgeregtes Murmeln um sich herum, so als würden die Toten ihnen Geschichten erzählen. Sie verspürten die unwirtliche Kälte des Todes auf ihrer Haut, die sie sich nicht einbildeten, weil es die Kälte der uralten Gräber war, die bis tief in ihre Knochen drang. Sie schauderten davor zurück und Oliver, auf den es die meisten der Geister abgesehen hatten, wurde von vielen Toten gleichzeitig bedrängt. Der Verwalter erstarrte und riss die Augen entsetzt auf, als er eine kalte Hand spürte, die seine berührte und fast hätte er aufgeschrien, weil diese Hand ihn fest griff und ihn kraftvoll vom Pferd ziehen wollte.
Dann plötzlich, ehe Oliver dazu kam zu schreien, war alles vorbei. Morwenna hatte ihren Weg ungestört mit Hilda aus dem Totenreich gefunden und schloss zu ihnen auf. Sie stand neben Ilari, der sie beruhigt ansah und da beruhigte sich auch Oliver Hurst wieder. Er beobachtete die Toten und konnte sehen, wie sie zurück in ihre Gräber stiegen. Die Körper tauchten in die harte, kalte Erde ein und verschwanden mit einem lauten Seufzen im Boden. Dann war wieder Ruhe um sie herum und sie vernahmen das unablässige Krächzen der Raben, die in einem großen Schwarm über sie hinwegzogen, so als wollten sie sich vergewissern, dass es tatsächlich Menschen gab, die dem Totenreich erfolgreich widerstanden hatten. Die Gruppe ritt unter Sadies Führung einige Minuten weiter über die Gräber und Augenblicke später lichtete sich der Nebel und die Sonne stand wieder wär¬mend am Himmel. Sie bemerkten den Falk wieder, der in einem weiten Bogen um die Gräberfelder floss. Sie hielten sich von da an eng am Fluss, sodass sie sein sanftes, fröhliches Rauschen stets hören konnten, das ihnen schon vertraut war und sie beruhigte.
Sie zogen befreit und glücklich weiter, bis sie etwas später vor einem Berg standen, den es hier gar nicht geben konnte.
„Dieser Berg ist eine Einbildung. Ihn darf es hier nicht geben. Es gibt ihn hier nicht“, sagte Oliver aufgebracht, der die Gegend um Falkenweld wie seine Westentasche kannte. Er ritt zweifelnd auf den Berg zu und berührte den Fels und musste sich überrascht eingestehen, dass das Gestein greifbar war, was auch immer er davon hielt. Oliver schüttelte den Kopf und hatte keine Lust mehr auf diese Reise.
„Du hast ganz recht, Oliver, wir haben den Berg zumindest bei unserer Reise hierher über das Land nicht gesehen“, bemerkte Ilari und seine Miene verdüsterte sich, weil er vermutete, dass ihnen wieder eine Prüfung ins Haus stand. „Müssen wir hinter den Berg gelangen, Hilda?“, fragte Ilari und sah sie abwartend an. Hilda lächelte und nickte.
„Sollen wir um das Ungetüm herumreiten? Oder nützt uns die Schlucht, die vor uns liegt, um hinter den Berg zu gelangen? Ich sehe ein zartes Grün hinter dem Einschlupf. Seht ihr es nicht auch?“, fragte er die anderen und sah zu, wie Sadie schon unbeirrt in die Felsspalte ritt, die von vergangenen Mächten einstmals in den Fels hineingesprengt worden war.
Die Schlucht war am Boden schmal und eng, weitete sich aber nach oben. Sie streckte sich zum sanften Licht des Tages empor, das von den Felsbrocken, die zwischen den Felswänden steckten, gehindert wurde und nur gedämpft zu ihnen nach unten schien. Etliche der Felsbrocken machten den Anschein, als ob sie von übermütigen Trollen hineingeworfen worden waren, und hingen verkeilt nur knapp über den Reitern im Fels. Doch wirkten die Steine so, als könnten sie sich jederzeit lösen und alles unter sich begraben.
„Glaubst du, dass die Brocken sich lösen können?“, fragte Ilari zweifelnd Theodric, der hinter ihm ritt. Der Herzog von Falkenweld misstraute dem Ganzen, seit sie an den Gräberfeldern dem Tod in die Augen geblickt hatten. Theodric, der Ilaris Frage nicht zweifelsfrei beantworten konnte, schwieg zuerst lieber. Doch Ilari sah ihn unentwegt an.
„Ich kann nicht leugnen, dass ich ebensolche Gedanken habe, Ilari“, sagte Theodric und sah ein wenig irritiert nach oben. „Von hier unten sieht es zweifelsohne so aus, als wollten uns die Steinbrocken geradewegs erschlagen. Doch uns wird nichts anderes übrigbleiben, als einen Schritt vor den anderen zu setzen und die Schlucht hinter uns zu bringen.“ Und als er trotz seiner Bedenken hinter Sadie in die Schlucht einritt, neigte er eilig den Kopf. Ilari wehrte sich innerlich dagegen, aber auch ihm blieb nichts anders übrig als, wie Theodric vor ihm, mit gebeugten Kopf unter den Felsen hindurch zu reiten.
„Wagt es nur nicht, ihr niederträchtigen Felsbrocken“, murmelte er drohend, als er direkt unter ihnen stand und seitlich zum mächtigsten Felsbrocken emporblickte. Ilari war von diesem gewaltigen Anblick ganz gebannt, aber er war nicht mehr ängstlich. Und es schien ihm einen flüchtigen Augenblick lang so, als wollte der hinterhältige Stein ihn tatsächlich endlich totschlagen für seine unablässige Kritik und seinen steten Argwohn. Ilari wartete noch einen Moment lang ab, doch nichts geschah. Er ritt zu guter Letzt fast schon enttäuscht weiter. Er hatte etwas anderes erwartet. Schließlich erreichten sie ohne Zwischenfälle das Ende der Schlucht. Doch kaum hatten sie sie alle verlassen, polterte und grollte es hinter ihnen, als würde die ganze verdammte Schlucht in sich zusammenbrechen. Dann war ein leises Lachen zu hören, das schrill anstieg und den Reitern zuletzt das Blut in den Adern gefrieren ließ.
„Ist das immer so, wenn ihr durch die Schlucht reitet?“, fragte Ilari neugierig Hilda, die neben ihm war. Hilda lächelte verwundert.
„Wir haben so etwas noch nie erlebt, mein Herr“, sagte sie. „Aber wir weichen auch nicht vom Weg ab und verhalten uns nicht wie ihr, der nicht die richtige Demut zeigt angesichts solcher Machtbezeugungen. Wenn ihr die alten Mächte anzweifelt, Herr, während ihr die Schlucht durchquert, dann werdet ihr nicht ungestraft ihr Ende erreichen. Nur wer ergeben und widerstandslos die Schlucht durchquert ohne zu zweifeln und seinem Schicksal freudig entgegensieht, wird nicht verlacht. Ihr habt jedoch einen störrischen und kritischen Sinn und lasst euch nicht so leicht von den Geistern der letzten Jahrtausende einschüchtern. Deshalb werdet ihr von ihnen ermahnt“, sagte sie jetzt lächelnd und es gefiel ihr, dass es solche Menschen wie ihren neuen Herzog gab, die sich allem mutig widersetzten. Sollten sich die Geister ruhig einmal mit solchen Menschen auseinandersetzen, die nicht zauderten angesichts ihrer Macht und sich nicht ins Bockshorn jagen ließen, wenn die Geister ihnen erschienen. Diese Menschen waren viel stärker, als den Geistern der Vergangenheit lieb war. Sollten es die Geister endlich einsehen. So ritten sie weiter und Ilari dachte über Hildas Worte nach. War er wirklich so aufmüpfig und störrisch, wie sie es beschrieb? Er hielt sich für anpassungsfähig und duldsam. Ilari beschloss, weniger zweifelnd und etwas demütiger zu werden. Er hoffte, er würde seine guten Vorsätze durchhalten. Es käme schließlich seinem Kind zugute. Er wollte ihm ein gutes Vorbild sein und mit einem Mal erkannte er, dass er nicht wie sein Vater Thorbjörn geraten war, der sicher dieselben Gedanken gehabt hatte. Und vielleicht hatte sich sein Vater schon immer über ihn gewundert.
Als Ilari, der gedankenverloren weitergeritten war, aus seinen Grübeleien aufschreckte, sahen sie in eine Bergschlucht hinein, durch die von weiter oben ein rauschendes Wasser den Fels hinunter stürzte. Als Ilari ein Stück nach vorne rückte, sah er, ein wenig weiter rechts oben gelegen, einen schmalen, aber lebhaften Wasserfall, der mit weißer, rauschender Gischt in den Fluss hinabstürzte. Auf seinem Weg dorthin floss er ein Stück waagerecht auf ein Felsloch zu und strömte hindurch, als es seinen Weg kreuzte. Von ihnen aus gesehen wirkte das Loch wie ein Auge. Das musste Kalias Auge sein, fiel Ilari ein, der an den Spruch der Frauen in seiner Burg dachte. Zu ihren Füßen wartete nun wieder der kleine, muntere Fluss Falk, um sich mit dem fallenden Wasser des Auges zu vereinen. Gemeinsam wie gute Freunde bogen die Gewässer nach links in wilden Strudeln ab, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Es war ein Abschied bis zu ihrer Rückkehr. Sie mussten nun den Wasserfall überqueren und Ilari blickte für einen Moment zweifelnd auf den Fels mit dem Loch. Er hatte ein starkes Gefälle und war nicht sehr breit, reichte aber von der anderen Seite des Berges bis zu ihnen. Sadie, die den Fels wie eine Brücke nutzte, um den Wasserfall zu überqueren, ritt vorsichtig, aber zügig mit ihrem Pferd den moosbewachsenen Weg hinauf. Es sah sehr abenteuerlich aus, da der Weg abschüssig war und nicht enden wollte.
„Seht euch vor, das Moos ist glitschig und rutschig von der Gischt des fallenden Wassers“, rief sie nach hinten und erklomm selbst angestrengt, aber mit sicherem Tritt die Brücke über die Schlucht, die nur wenig mehr als einen Meter breit und ohne seitliche Begrenzung vor ihnen lag. Ilari sorgte sich um Morwenna, die heute schon so viel hatte erdulden müssen, und sah sie prüfend an. Sie schien zwar nicht erbaut davon zu sein, dort hinaufzureiten, aber sie zitterte und zauderte nicht. Sie lächelte Ilari zu und ritt an ihm vorbei, um vor ihm auf die andere Seite zu gelangen. Hilda bat sie, vorsichtig zu sein, aber Morwenna reagierte nicht mehr auf ihre Ermahnung und ritt forsch weiter. Mit der schlafwandlerischen Sicherheit einer schwangeren Frau, die weiß, wie sie zu gehen hat, leitete sie ihren Braunen über die Brücke. Es ging anfangs so steil nach oben, dass die Pferde dem abweisenden Weg misstrauten. Doch die Menschen beruhigten ihre Tiere mit aufmunternden Worten, gaben ihnen die Sporen und trieben sie damit tapfer voran. Sie störten sich nicht daran, klamm und nass zu werden, da sie nichts gegen das kühle Nass tun konnten, das sie fortwährend mit feinen, seidenen Tropfen traf, als es den Berg hinunterstürzte.
Als sie schließlich ohne Zwischenfälle erleichtert oben am Hang angekommen waren, erreichten sie eine freundliche Waldlichtung, die still und friedlich vor ihnen lag. Die Geräusche des fallenden Wassers waren an diesem Ort nicht mehr zu hören, obwohl er in unmittelbarer Nähe lag. Ilari runzelte die Stirn. Irgendetwas schien auch hier nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Die plötzliche Stille erschütterte ihn, der sich schon an das heftige Tosen des Wassers gewöhnt hatte. Als er Sadie hinterhersah, die sich schon wieder in Bewegung gesetzt hatte und vor ihm verschwand, meinte er, direkt in Cialaes Gesicht zu blicken. Es musste es einfach sein, so wie es im Spruch beschrieben wurde. Ein Fels, der unmittelbar vor ihm lag, trug die Züge eines mürrischen Frauengesichtes. Und das Moos, das über die Kanten wuchs, schien sein kräftiger Haarkranz zu sein. Das Gesicht sah jeden durchdringend und prüfend an und sogar Theodric musste sich zusammennehmen, den abweisenden Blick des Steines zu ignorieren und weiterzuziehen. Wie Sadie ritten sie auf die moosbewachsene Stirn Cialaes hinauf und weiter in die Lichtung hinein, bis sie, oben angekommen, den Horizont vor sich erblickten.
Sie ritten durch den kleinen Wald, der links von ihnen leicht anstieg, und als er endlich aufhörte, bot sich ihnen ein atemberaubender Blick auf das Tor einer verfallenen Burg, Tausende von Jahren alt, das vor ihnen stand und seine Torflügel einladend geöffnet hielt. Als sie von ihren Pferden abstiegen und nähertraten, konnten sie durch die Tore der Burgruine sehen. Sie erblickten eine verwitterte Steilküste, die sich endlos in ein tosendes Meer hineinzog und sahen auf die Brandung des stürmischen Meeres hinunter, das es hier nicht geben konnte mitten im Festland Ambers. Alle waren sich darüber im Klaren und trotzdem erhob keiner die Stimme zum Widerspruch. Sie nahmen es einfach hin. Bis auf Ilari, der zornig wurde, weil er es leid war, der Spielball ferner Mächte in Konbrogi zu sein. Er stand am Tor und überschlug sich beinahe in seiner Wut.
„Hört auf mit eurer Scharade, ihr Fürsten des Nebels“, schrie er aufgebracht der tosenden Brandung entgegen und reckte seine Faust dabei zornig in die Höhe. „Es ist keine Freude, eurem Weg zu folgen. Er wird uns noch zum Verhängnis. Warum täuscht ihr unsere Sinne? Ist es wieder eine Prüfung oder sollen wir uns verirren, damit ihr einen hübschen Spaß mit uns habt. Wenn ihr mich hört, dann ermahne ich euch, dieses Spiel zu beenden und uns ruhig weiterziehen zu lassen. Habt ihr mich gehört?“, fragte er den stürmenden Winden entgegen. Doch es blieb still. Nichts regte sich oder beantwortete Ilaris zornige Worte. Da stieg ein so gewaltiger Ärger in ihm hoch, dass er den Entschluss fasste, sofort umzukehren und den heiligen Hain zu vergessen. Es widersprach zwar seinem nüchternen Sinn, den er aber auf dem Weg hierher verloren hatte. Und so stand er eine Weile vor dem Tor der Könige und haderte mit seinem Schicksal, bis ihn Theodric an die Schulter fasste.
„Ich denke nicht, dass die Fürsten der Nebelwelten hinter diesen Vorkommnissen stecken, Ilari. Hier sind ältere Mächte am Werk. Mächte, die sich wie Ewen nur schwer damit abfinden können, dass wir Menschen ihre Insel bewohnen. Wir sind Lebewesen, die sich durch nichts vertreiben lassen und die ihnen immer in die Quere kommen. Sie versuchen, uns zu vernichten, aber wir werden den heiligen Hain erreichen und uns mit den Nebelfürsten vereinen, die sie, so denke ich, in Schach halten können. Von Falkenweld aus werden wir die Tore zu den Nebelländern wieder öffnen, auch wenn die finsteren Mächte Ambers alles daransetzen, es zu vereiteln. Denk daran, hier geht es nicht um uns, sondern um ganz Amber und um unser Daseinsrecht auf dieser Insel. Daher darfst du unseren Weg nicht vorzeitig beenden und die Gemeinschaft auflösen, sondern du musst demütig bis zum Ende mit uns gehen, wie es Sadie und Hilda schon ihr Lebtag lang tun. Demut und Ergebenheit sowie Anpassung und Vielseitigkeit sind unsere Waffen. Diese Waffen sind gefährlicher und machtvoller, als es den Geistern der Vergangenheit lieb ist.“ Theodric schwieg wieder, weil er bemerkte, wie sich das Wetter, während er sprach, deutlich verschlechtert hatte.
„Lasst uns endlich weitergehen. Seht ihr nicht, wie sich das Wetter verschlechtert? Bald wird es zu spät sein, den Weg nach unten zu nehmen“, sagte er mahnend. Als er Sadie in die Augen sah, wusste er, dass sie das Gleiche befürchtete. Er klopfte Ilari ein letztes Mal aufmunternd auf die Schulter und nahm die Zügel seines Pferdes. Sadie und Hilda, die den Weg schon kannten, stiegen von ihren Pferden. Sie mussten die Tiere den steilen, schmalen und endlos gewundenen Pfad zum Meer hinunterführen. Zusammen mit Theodric und den anderen durchschritten sie das Tor der Könige und stiegen langsam und bedächtig hinab zur Bucht. Ilari seufzte, denn wie lange er auch hier weiter zornig auf das Meer blickte, es würde nicht verschwinden, bloß, weil er es sich wünschte. Es war da und nässte die helle Bucht mit seinen flinken, tiefblauen Wellen. Der Salzgeruch des Meeres stieg ihm unablässig in die Nase und er ergab sich seinem Wunsch, endlich wieder einmal an der Küste eines Meeres zu stehen, was er schon schmerzlich vermisste, seit er die Heimat verlassen hatte. So tat er es den anderen gleich und folgte ihnen zügig.
Doch ehe sie die Bucht am Ende des Weges erreichen konnten, tat sich eine flache, weite Höhle vor ihnen auf, die ihnen den Weg zum Meer versperrte. Ihre Eintrittspforte war ein dunkler, gähnender Schlund, der wenig einladend aussah und sie direkt tief ins Innere der Erde führte. Sie zögerten, dort hineinzugehen. Aber sie erinnerten sich, von oben gesehen zu haben, dass es das Meer wirklich gab, an dessen Ufer sie stehen wollten. Dennoch war es wenig verlockend, Hilda und Sadie zu folgen, die schon vorausgegangen waren. Da verlor Ilari die Geduld und gab seinem Pferd die Sporen.
„Wenn sich niemand sonst aufrafft, dort hineinzugehen, dann werdet ihr eben ohne mich hier stehenbleiben müssen. Auch wenn das Loch feindlich, düster und eng aussieht. Ich, Ilari Thorbjörnson, werde es nach den Frauen durchschreiten und am anderen Ende meine schmerzenden Füße in frisches Meerwasser tauchen. Also verzagt nicht. Nehmt diese neuerliche Herausforderung an und folgt einem Nordmann unter die Erde“, rief er fast schon aufmunternd und war im nächsten Augenblick verschwunden. Morwenna stutzte.
„Er lässt mich einfach zurück“, sagte sie nachdenklich. „Habe ich solch einen Mann geheiratet, der mich verlässt, wann immer es ihm gefällt?“ Sie sah auf die Höhle und schauderte. Sie hätte sich gerade jetzt Ilari an ihrer Seite gewünscht und wurde weinerlich. Das kam bestimmt von dem Kind, das sie in sich trug, und gerade als sie auf Ilari zornig werden wollte, kam er wieder aus der Höhle herausgestürzt.
„Es ist gar nicht schlimm. Sogar hell genug, um nicht fehlzugehen. Auch ist das Wasser am Boden nicht tief“, rief er und ritt zu Morwenna, die ihn verwundert ansah. Damit hatte sie nicht gerechnet. „Komm nur, Morwenna, eile dich. Hinter uns sind schwere Regenwolken aufgezogen. Wenn du nicht nass werden willst, dann flüchte dich mit mir in die Höhle.“ Er wartete nicht ab, was sie dazu sagen würde, griff sich die Zügel ihres Braunen und ließ kein Widerwort zu. Morwenna folgte ihm in die kühle Höhle, die höher war, als sie es erwartet hatten. In ihrem Inneren bedeckte flaches Meerwasser den Boden und reichte bis an die Knöchel ihrer Pferde. Ein Fischerboot lag am Ufer der steilen Wände, die sich glatt und endlos in die Höhe schraubten. Die Wände und die Menschen wurden in ein bläuliches und sanftes Licht getaucht. Die Felsen waren moosgrün bewachsen und glitschig und kühl. Das Innere der Höhle verbreitete einen modrigen und fauligen Geruch, wie wenn die frische Luft der Welt seit Jahrhunderten ausgeschlossen wäre. Das Fischerboot lag am Ufer ihnen gegenüber. Es schaukelte einladend im Wasser, das direkt aus der Wand zu fließen schien. Nirgends sah man einen direkten Zufluss und doch floss fortwährend Wasser aus der steinernen Wand in die Höhle und plätscherte fröhlich auf die Wasseroberfläche. Das Boot lag in Richtung der Wand und seltsamerweise nicht zum Ausgang der Höhle gerichtet, was Morwennas Aufmerksamkeit erregte. Den anderen schien es gar nicht aufzufallen und Morwenna, die Ilari bisher treulich gefolgt war, fühlte sich magisch angezogen davon, das Boot in die richtige Position zum Meer zu bringen. Als Ilari für einen Augenblick ihre Zügel losließ, drehte sich Morwenna, die jetzt die Letzte im Zug war, sofort um und ritt auf das Boot zu. Sie vernahm dabei ein stilles Lied, das sie weiter zum Boot lockte. Sie erreichte es in Minutenfrist und ehe Ilari sie vermisste, stieg sie schon vom Pferd, um das Tau des kleinen, freundlichen Bootes zu ergreifen. Sie streckte eben ihre Hand nach dem feuchten Tau aus, als ein durchdringender Schrei die Höhle zum Erzittern brachte.
„Nicht, Herrin! Lasst das Tau liegen, kommt her, ihr könnt das Boot nicht verändern. Die Felswand ist erschaffen worden, um Unheil von uns fernzuhalten. Wenn ihr jedoch das Tau ergreift, wird sich die Wand öffnen und das Wasser wird seine Richtung ändern. Ihr werdet zusammen mit uns von dem Boot, dessen Tau ihr nicht wieder loslassen könnt, in die Tiefe der Welt gezogen und werdet nie wieder einen Weg hinaus finden. Wir werden uns dort verirren und bis zum Ende aller Tage gezwungen sein, im Finsteren zu wandeln“, rief Hilda erschrocken. Als Ilari nach vorne stürzen wollte, um Morwenna von ihrem Vorhaben abzuhalten, wurde er wie von einer unsichtbaren Mauer, an der er rüde anstieß, gebremst. Keiner von ihnen war mehr in der Lage, die unsichtbare Mauer zu überwinden und Morwenna zu erreichen, bis sie sich nicht selbst entschlösse, wieder ihr Pferd zu besteigen und sich zu ihnen umzuwenden. Morwenna stand dort vor dem Boot und blickte zurück auf Ilari, der aufgeregt zu sein schien, ebenso wie die anderen, die offenbar durch irgendetwas erschreckt waren. Morwenna, die noch grübelte, griff wieder gedankenverloren nach dem Tau, und eben, als sie es erfassen wollte, rührte sich in ihrem Inneren etwas. Sie spürte das Kind, das sie in sich trug, wie ein leises, aufgeregtes Flattern. Als hätte es Angst vor dem, was seine Mutter gerade tun wollte. Morwenna lächelte, weil sie ihr Kind zum ersten Mal spürte. Als sie die Hand vom Tau nahm und auf ihren Bauch legte, beruhigte sich ihr Kind und das Flattern verschwand. Morwenna hatte die Nachricht verstanden. Sie begriff nun die Worte Hildas, die ihr vorher wie unbegreifliches Kauderwelsch erschienen waren, wandte sich vom Boot ab und bestieg glücklich ihr Pferd. Sie ritt auf die anderen zu und vergaß augenblicklich das Boot, das nun so liegenbleiben musste, bis sich ein anderer fand, der sich erbarmte. Als sie Ilari berührte, wusste sie, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Sie ritten dem fließenden Wasser hinterher aus der Grotte heraus und hofften, bald am Saum der Höhle die Ufer des fremden Meeres zu erreichen. Doch als das Tageslicht wieder hell und gleißend hereindrang und der Duft der lebenden Welt den Modergeruch der verwunschenen Höhle verdrängte, standen sie nicht an der Brandung eines Meeres, wie sie es erwartet hatten, sondern erreichten den samtigen Pfad eines Waldes, der sich unerwartet vor ihnen auftat. Das Wasser, das aus der Höhle hinter ihnen herausfloss, versickerte mit einem feinen Zischen im Boden und war für immer verschwunden. Ilari wunderte sich, bis sein Blick von dem lichten Wald gefesselt wurde, der ein fröhliches Gezwitscher unzähliger Vögel hören ließ. Der Boden war bis auf den Pfad rechts und links völlig mit wildem, fast mannshohem Farn bedeckt. Gerade als sie den Pfad entlangritten und sich Ilari daran sattsehen wollte, standen sie vor einer gewaltigen Buche, deren Stamm völlig von Moos bewachsen war und deren Äste weit ausladend in den Himmel wuchsen. Sie ließen das blaue Licht des Himmels nur spärlich hereinfallen. Wie ein zweites Himmelsdach aus dem Braun der Äste und dem kräftigen Grün der Blätter wuchsen die Triebe der Buche in die Luft und bildeten ein schützendes Dach über den Reitern. Zehn Männer hätten nicht ausgereicht, um den ewigen Stamm dieser ehernen Buche ganz zu umfassen. Genau hier dürstete es Morwenna zu rasten, weil ihr die Anstrengung des Weges den Atem zu nehmen drohte. Als sie zweifelte, ob sie hierbleiben sollte, denn es wäre fraglos besser gewesen, das Ende des Weges endlich zu erreichen, hörte sie den Baum leise flüstern, in einer Sprache, die sie nie vorher gehört hatte, die sie aber verstand. Jedes einzelne seiner Worte verstand sie und sie wollte mehr hören von den alten Zeiten, von denen die Buche berichtete, bis sie wieder Hilda an ihrer Seite hatte, die sie wortlos an den Zügeln ihres Pferdes weiterzog. Morwenna als werdende Mutter spürte und verstand mehr als die anderen. Sie lief aber auch am meisten Gefahr, sich zu verlieren in den Zeiten, die vergangen waren und die nicht mehr wiederkehren konnten. Sie musste wieder von Hilda ermahnt werden. Hildas Stimme durchdrang endlich das Flüstern der uralten Buche und verdrängte deren Wünsche an Morwenna.
„Kommt mit, Herrin“, sprach ihr Hilda ruhig zu. „Rastet nicht und hört nicht auf die vergangenen Geschichten der Welt, die die ewige Buche erzählt, sonst werdet ihr euer Kind an die Buche verlieren, die sich etwas Lebendes wünscht. Euer Kind wird sich, wenn ihr länger hier verweilt, nur noch wünschen, vom Flüstern der Buche getragen zu werden, sobald es geboren ist“, hörte sie Hilda sagen, die weit entfernt von ihr zu sein schien. Erst als sie sich um ihres Kindes Willen fügte und die tausend verschlungenen Äste der Buche verlassen hatte, die sie vermeintlich beschützten, verschwand endlich das Flüstern aus ihrem Kopf und sie atmete ruhiger. Sie erkannte Ilari wieder und erinnerte sich, warum sie hierhergekommen waren.
„Die Kriege der früheren Welt waren schrecklich“, begann sie den anderen zu berichten und wollte weitererzählen, doch hatte sie die Worte plötzlich vergessen und sie atmete erleichtert auf.
„Das Vergessen ist gut“, sagte Sadie schlicht. „Kein menschliches Wesen sollte mit den traurigen Schicksalen der Vergangenheit belastet werden. Lasst den Baum sich damit herumschlagen. Ihr tragt die Zukunft in euch und die wollt ihr sicher nicht missen, auch wenn ihr an die Schrecken denkt, die euch erwarten beim Sturm auf Amber. Seid gewiss, es wird nicht so enden, wie ihr es befürchtet. Denkt an meine Worte, wenn ihr in der Zukunft einmal am Verzweifeln seid, dann, wenn das Liebste für euch verloren scheint, das ihr einmal besaßt.“
Die Farne am Boden wurden flacher und ein Weg nach Norden zeichnete sich ab.
Sie ritten einen langen, dunklen Pfad, der von hohen Bäumen überwachsen war, entlang und gerieten fast schon ohne Hoffnung, den heiligen Hain endlich zu erreichen, auf eine Lichtung, die hell und großzügig vor ihnen lag.
„Hier sind wir endlich an der richtigen Stelle“, rief Theodric. Sadie lachte und nun war sich Theodric ganz sicher. Sie hatten den Ort der Bruderschaft der Nebelpriester erreicht. Gerade als er es vor Aufregung nicht mehr aushielt, sahen sie zwischen schlanken, jungen Buchen vor sich den heiligen Hain. Acht übergroße Buchen und Eichen, die im Rund standen und in deren Mitte sich ein Fels erhob, der wie ein Opferstein wirkte. Sadie und Hilda hielten an und stiegen müde vom Pferd. Sie traten an den Stein und opferten mitgebrachte Gaben, die sie unter murmelnden Worten dort ablegten. Hier fühlten sich die Menschen unerwartet wohl und geborgen. Sie setzten sich erleichtert in das Gras vor ihren Füßen und verzehrten in aller Ruhe die Dinge, die sie mitgebracht hatten. Hier war ein sicherer Ort.
Das Licht, das den Boden der Lichtung erreichte, war anders als zuvor auf dem Weg hierher. Ilari erinnerte es sehr deutlich an die Gärten der Nebelfürsten, die hinter der Ratshalle der Konbrogi in Wallis lagen. Auch dort war das Licht eindringlicher, aber für Menschenaugen, die es nicht kannten und die die Nebelländer fürchteten, fremd und bedrohlich. Ilari fühlte sich seltsamerweise geborgen. Er hatte viel zu lange Zeit bei Leana zugebracht und mit den Nebelländern zu tun gehabt, als dass ihm diese Lichtung und der Hain Furcht einflößen konnten. Die Dienerinnen sahen die Freude des Wiedererkennens in Ilaris Augen und wussten, dass er der richtige Herzog für Falkenweld war. Auch Morwenna, die ein natürliches Begehren verspürte, mit den unbekannten Welten der Nebelländer verbunden zu sein, fühlte sich auf Anhieb geborgen im Priesterorden der Nebel in Falkenweld. Sie hatte gestern die richtige Entscheidung getroffen, als sie beschlossen hatte, den einstmals geachteten Priesterorden wieder aufleben zu lassen.
Nach einer Weile hielt es Theodric nicht länger aus. Er stand auf und wanderte unruhig herum. „Können wir endlich die alten Gebäude der Bruderschaft ansehen“, bat er Hilda und sie verstand ihn.
„Wir waren schon lange nicht mehr dort, aber wir zeigen euch gerne, wo sie sind. Nur erwartet keine prachtvollen Gemäuer“, sagte sie und ging los. Sie liefen über die weit ausladende Lichtung, die kein Ende zu haben schien, und als sie den Wald wieder erreichten, der hinter den heiligen Bäumen stand, sahen sie vor sich, versteckt in hochgewachsenen Farnen und Sträuchern, die verfallenen Gebäude der Priester. Es war einstmals eine kleine Wehranlage gewesen, die von einer Mauer umgeben war und in deren Innern sich vier weitläufige Gebäude befanden, die einen großen rechteckigen Hof bildeten, der zur Ruhe und Muse taugte. In der Mitte des Hofes stand eine Buche wie die, die sie vorher gesehen hatten. Sie war genauso hoch und weit gewachsen, doch von ihr ging keine magische Botschaft aus. Sie stand, als stünde sie seit Urzeiten dort. Einstmals hatte sie eine Bank umrundet, die jedoch schon vom Stamm der Buche gesprengt worden war. An einer Seite konnte man noch sitzen und Morwenna, die müde war, setzte sich. Sie schlief sofort erschöpft ein und diesmal hatte sogar Hilda nichts dagegen einzuwenden, dass sich Morwenna im Schutz der Buche aufhielt.
„Lasst sie ruhen. Es gibt keinen sichereren Ort für sie, um Kraft zu schöpfen“, sagte Hilda und ging mit den anderen los, um die Gemäuer zu erkunden. Alle Räume waren leer und vielen fehlte das Dach.
„Hier kann es keine Bücher mehr geben. Sie wären, hätten sie so lange hier gelegen, einfach vergangen“, sagte Theodric erstaunt. Aber dann fiel ihm ein, dass jedes Gebäude einen Keller besaß. Sadie, die Theodrics blitzende Augen sah, verstand ihn plötzlich.
„Ja, es gibt einen Keller und seine Räume sind intakt, wenn auch von Viehzeug und Ungeziefer besetzt“, sagte sie lachend und ging Theodric voran in ein verfallenes Gebäude, das sie schon vorher betreten hatten, dessen Treppe in den Keller sie aber nicht sehen konnten, weil eine Bodenklappe den Eingang verdeckte. Sie war so geschickt gefertigt, dass ein ungeübtes Auge nicht erkannte, wo sie lag. Sie schien fest mit dem Boden verwoben zu sein, und als Theodric an die Stelle trat, die ihm Sadie wies, erkannte er erst bei sehr genauem Hinsehen die kleine Klappe, die man öffnen musste, damit man die Luke hochziehen konnte. Theodric zögert keine Sekunde, ergriff die Klappe und zog energisch daran. Knarrend und quietschend öffnete sich der Boden vor ihm und gab eine steinerne Treppe frei, die verwinkelt in die Tiefe führte. Einige Fackeln, die an den Wänden angebracht waren, hätten Licht gespendet, hätte man Feuer zur Hand gehabt. Aber auf ein Feuer wollte Theodric nicht warten, weil er sah, dass ihm das Licht ausreichte, um hinunterzugelangen. Es trieb ihn etwas, dorthin zu gehen, und als er auf der Treppe stand, wusste er, dass seine Entscheidung richtig war. Er ging mit sicherem Schritt hinunter und unten angelangt weiteten sich seine Augen vor Überraschung. Ein ganzes, lichtes Kellergewölbe tat sich auf. Doch Theodric hatte Schwierigkeiten etwas zu sehen. Er tastete sich unsicher vorwärts, stolperte über gefallene Gegenstände, die am Boden lagen, und stieß schmerzhaft gegen einen Tisch, der mitten in diesem Raum stand.
„Es muss die Bibliothek sein“, murmelte er und wollte vorwärts gehen, aber er kam nicht am Tisch vorbei, der endlos zu sein schien. Er fluchte und stieß sich erneut an der Hüfte, als ihm plötzlich ein Licht erschien.
„Danke, ihr Götter“, murmelte er und wollte schon auf die Knie sinken, als er Ilaris Stimme hörte.
„Keine Götter“, sagte Ilari. „Oliver hat ein Feuer entzündet, weil er nicht wollte, dass ihr euch hier verirrt.“ Ilari trug zwei Fackeln in den Händen und gab die eine seinem besten Freund. Theodric lächelte ein wenig zweifelnd. Hatte er doch schon übermenschliches Eingreifen vermutet. Aber es war ihm egal, weil er, als er sich umsehen konnte, die Wände mit Regalen vollgestellt entdeckte, die unzählige Bücher und Schriftrollen enthielten.
„Da hast du Arbeit für mehrere Menschenleben“, sagte Ilari nüchtern, aber selbst froh, nicht in diesen Keller gezwungen zu sein, um sich hier durch den Blätterwald zu kämpfen. Doch Theodric schien das alles nichts auszumachen.
„Hoffentlich gibt es einen Wegweiser durch dieses Chaos“, sagt Ilari spitz und da leuchteten Theodrics Augen erneut. Eine Anleitung zur Nutzung der Bibliothek gab es überall. Wie konnte er das nur vergessen haben. Er suchte eine Weile und fand sie bald. Nun war es leicht. Als er sich still darin vertiefte und nicht mehr ansprechbar war, verlor Ilari endgültig die Geduld.
„Wie lange hast du vor hierzubleiben?“, fragte er ihn ungeduldig. „Ich wollte jetzt zurückkehren, um mein Abendessen zu Hause einzunehmen. Da erst sah ihn Theodric entsetzt an. Er wollte diesen Ort nicht mehr verlassen, nicht bevor er alle Erkenntnisse hatte, die er brauchte, um die Gefahr abzuwenden, die den Nebelfürsten durch Fürst Berrex, dem dunkelsten und gefährlichsten aller Fürsten, drohte. Ilari verstand ihn gut, winkte aber ab, denn er hatte andere Vorstellungen. Er nahm Theodric wieder mit an das Tageslicht, weil er wusste, dass mit ihm dort unten kein vernünftiges Wort zu wechseln wäre. Oben angekommen sahen sie Morwenna auf sich zukommen. Sie prüfte die verfallenen Gemäuer und sah, dass es viel Arbeit kosten würde, um sie erneut zu erbauen. Sie konnte sich aber den ehemaligen Glanz vorstellen, der auf diesem Ort lag. Sie lachte erfreut, als Theodric sie erstaunt ansah und erkannte, wie es um Morwenna bestellt war. Die Schwangerschaft machte sie empfänglicher für das Übernatürliche und Theodric wusste auf einmal, dass ihr Kind sicher ein Priester der Nebel werden würde. Es war zu offensichtlich, was die Götter mit Morwenna vorhatten. Theodric hatte schon eine Weile bei den Schriften des Ordens zugebracht, aber noch nicht die entscheidende Rolle gefunden, die er suchte. Er wusste, dass die Zeit drängte, sah aber auch ein, dass man nur einen Schritt vor den anderen setzen konnte, und beschloss, die Dinge, die getan werden mussten, zu beschleunigen. Sein natürlicher Sinn für das Praktische überwog schließlich und er plante in Stundenfrist, wie der Orden mit den alten Gemäuern wiederaufgebaut werden sollte und erklärte es Morwenna.
„Zuerst will ich einige Zimmer im inneren Kern der Anlage errichten lassen, die die Schriften beherbergen sollen. Diese Räume werden mit einem guten Zauber vor feindlichen Blicken geschützt“, sagte er nüchtern. „Ich werde dann hierherziehen und mich auf dem Gelände einrichten. Dabei überwache ich mit den Freunden, die noch aus Konbrogi zu meiner Unterstützung unterwegs sind, die Bauarbeiten, die hoffentlich bis zum Feuerfest oder Gimradfest, das man hier im Winter feiert, beendet sind. Dann werde ich mich nach Hause aufmachen ins Tal der glücklichen Menschen, um mit meiner Mutter die Dinge zu besprechen.“
„Also, wenn dir das alles so klar vor Augen steht, dann wirst du mit mir noch zuverlässige Männer und Frauen auswählen müssen, die den Wiederaufbau des Ordens vorantreiben. Hilda und Sadie werden wissen, wer dafür in Frage kommt“, sagte Morwenna lachend und war glücklich, in Theodric eine so große Hilfe bekommen zu haben.
Eine Woche später schon war Theodric mit Hilda und Sadie und vielen Helfern auf dem Weg zum heiligen Hain. Sie arbeiteten ohne Unterlass und von Zeit zu Zeit gönnte sich Morwenna den Luxus, im Orden nach dem Rechten zu sehen. Jedes Mal kehrte sie begeisterter nach Hause zurück. Ilari machte sich an die Aufgabe, zusammen mit Oliver Hurst die Ländereien kennenzulernen. Sie stellten darüber hinaus ein Heer auf, das ausgebildet werden musste. Die Zeit war gut dafür, weil im Spätherbst und im Winter die Männer weniger Arbeit auf den Feldern hatten und sich mit der Waffenkunst und dem Kriegshandwerk beschäftigen konnten. So wie es Ilari in Tamweld gelungen war, eine waffenfähige Truppe auszubilden, so hatte er in kurzer Zeit einige fähige und starke Truppen zur Verfügung, die er seinem Freund Raedwulf Paeford anbieten konnte.